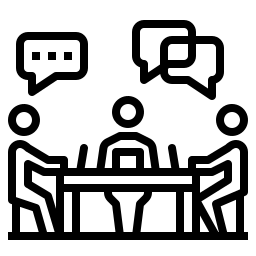Mein Weg in den Kontinuierlichen Einigungsfindungsprozess - Ein fiktiver Erfahrungsbericht
Es war ein gewöhnlicher Dienstagabend, als ich auf meinem Newsfeed über “Mach den Staat” stolperte. Die Überschrift versprach nichts Geringeres als eine Revolution der politischen Teilhabe. Skeptisch, aber neugierig, klickte ich auf den Link.
[HINWEIS: Dieser Artikel beschreibt eine fiktive Person und fiktive Erfahrungen. Der gesamte Inhalt wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und dient als Illustration des KEF-Konzepts.]
Fiktiver Bericht von Mara Berger, 28. März 2025
Die Entdeckung
“Politik als kreatives Werkzeug zur direkten Gestaltung durch die Bürger” – dieser Satz blieb bei mir hängen. Nach Jahren der Politikverdrossenheit und dem Gefühl, dass meine Stimme nur alle paar Jahre bei Wahlen zählt (und selbst dann kaum Gewicht hat), klang das zu schön, um wahr zu sein.
Der Einstieg
Die Registrierung war überraschend einfach. Nach einer kurzen Identitätsverifikation erhielt ich Zugang zur Plattform. Was mich sofort beeindruckte: Statt mit komplexen Menüs und Funktionen konfrontiert zu werden, lud mich die Startseite ein, zunächst das aktuelle Konsensdokument zu erkunden.
“Das ist unser gemeinsames politisches Programm”, erklärte mir ein kurzes Einführungsvideo, “aber anders als bei Parteien ist es nie fertig, sondern entwickelt sich ständig weiter – und du kannst ab sofort Teil dieser Entwicklung sein.”
Das Konsensdokument
Das Konsensdokument war übersichtlich in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Von Umweltschutz über Bildung bis hin zu Digitalisierung – jeder Bereich bestand aus mehreren Absätzen und Punkten.
Bei jedem Textfragment konnte ich drei Dinge sehen:
- Den aktuellen Konsenstext
- Eine prozentuale Zustimmungsrate
- Einen kleinen “Geschichte”-Button
Als ich zum Bereich Bildungspolitik kam, sprang mir sofort ein Absatz zur frühkindlichen Bildung ins Auge. Der Text befürwortete kostenfreie Kindergartenplätze ab dem ersten Lebensjahr. Die Zustimmungsrate lag bei 78%.
Meine erste Abstimmung
Ich stimmte mit diesem Punkt überein und klickte auf den grünen “Zustimmen”-Button. Ein kleines Popup informierte mich: “Deine Stimme wurde gezählt. Die Zustimmungsrate für diesen Punkt liegt nun bei 78,1%.” So einfach hatte ich gerade zum ersten Mal direkt an einem politischen Konsensprozess teilgenommen.
Beim nächsten Punkt – einer Forderung nach verpflichtenden Programmierunterricht ab der Grundschule – war ich jedoch skeptisch. Die Zustimmungsrate dieses Fragments lag bei 65%.
Ich klickte auf “Ablehnen”, doch anstatt einfach nur meine Ablehnung zu registrieren, öffnete sich ein Dialog mit mehreren Optionen:
- “Einfach ablehnen” – Meine Gegenstimme ohne weitere Begründung registrieren
- “Mit Begründung ablehnen” – Eine kurze Erklärung hinzufügen, warum ich nicht zustimme
- “Alternative Formulierung vorschlagen” – Einen eigenen, verbesserten Text einreichen
- “Historie einsehen” – Die Entwicklung dieses Punktes nachvollziehen
Neugierig geworden klickte ich auf “Historie einsehen”. Sofort öffnete sich eine Zeitleiste, die zeigte, wie dieser Punkt entstanden war. Ursprünglich war der Text anders formuliert: “Informatik-Grundlagen als Wahlfach ab der 5. Klasse”. Dieser ursprüngliche Vorschlag hatte eine Zustimmung von 89%.
Vor drei Monaten hatte jemand eine Änderung vorgeschlagen und den Text auf “verpflichtend ab der Grundschule” verschärft. Diese Änderung hatte die Zustimmungsrate deutlich gesenkt.
Die Verschiebung des Konsenses
Ich entschied mich für Option 3 und schlug eine Alternative vor: “Grundlegende digitale Kompetenzen als fester Bestandteil des Grundschulunterrichts, Programmieren als Wahlfach ab der 5. Klasse.”
Nachdem ich meinen Vorschlag eingereicht hatte, wurde er als “aktive Alternative” neben dem ursprünglichen Text angezeigt. Andere Nutzer konnten nun zwischen dem aktuellen Konsenstext und meiner Alternative wählen.
Eine Woche später erhielt ich eine Benachrichtigung: “Dein alternativer Vorschlag zur digitalen Bildung hat die Mehrheit erreicht und ist nun Teil des Konsensdokuments.”
Als ich nachschaute, hatte meine Version eine Zustimmungsrate von 74% erreicht, während die vorherige Version auf 58% gefallen war. Der Konsens hatte sich verschoben, und mein Beitrag war nun Teil des gemeinsamen politischen Willens!
Tieferes Eintauchen in den KEF
Je mehr ich mich mit dem System beschäftigte, desto faszinierender fand ich die Mechanik dahinter. Der KEF (Kontinuierlicher Einigungsfindungsprozess) funktionierte wie ein lebendiger Organismus:
-
Transparenz: Bei jedem Fragment konnte ich nachvollziehen, wer es ursprünglich vorgeschlagen hatte, welche Änderungen es durchlaufen hatte und wie die Zustimmungsraten sich entwickelt hatten.
-
Verschiebungen: Wenn neue Nutzer hinzukamen und abstimmten, konnten sich die Mehrheitsverhältnisse langsam verschieben. Das System informierte alle Beteiligten, wenn ein alternatives Fragment mehr Zustimmung erhielt als der aktuelle Konsenstext.
-
Diskussionen: Zu jedem Fragment gab es einen Diskussionsbereich, in dem Nutzer faktenbasiert argumentieren konnten. Besonders beeindruckend: Behauptungen mussten mit verifizierbaren Quellen belegt werden.
-
Verschiedene Abstimmungsebenen: Man konnte sowohl zu einzelnen Fragmenten als auch zu übergeordneten Abschnitten und ganzen Themenbereichen Stellung nehmen.
Der Mehrwert meiner Teilnahme
Nach einigen Wochen aktiver Teilnahme wurde mir bewusst, wie sehr sich mein Verhältnis zur Politik verändert hatte. Statt als ferner, undurchsichtiger Prozess erschien sie mir nun als etwas Greifbares, an dem ich direkt mitwirken konnte.
Besonders beeindruckte mich, wie schnell Änderungen wirksam werden konnten. Als eine lokale Verkehrsinitiative das Konsensdokument als Grundlage für Forderungen an die Stadtverwaltung nutzte, konnte ich direkt sehen, wie “meine” Textpassage zur Förderung des Fahrradverkehrs Teil eines konkreten Vorhabens wurde.
Herausforderungen und Grenzen
Natürlich ist nicht alles perfekt. Bei komplexen oder polarisierenden Themen kommt es vor, dass kein klarer Konsens erreicht wird. In solchen Fällen zeigt das System transparent die verschiedenen konkurrierenden Vorschläge mit ihren jeweiligen Zustimmungsraten.
Auch die Frage der Repräsentativität beschäftigt mich. Obwohl die Plattform sich bemüht, alle Bevölkerungsgruppen einzubeziehen, sind bestimmte demografische Gruppen noch unterrepräsentiert – ein Problem, an dem aktiv gearbeitet wird.
Fazit: Politik neu erleben
Vier Monate nach meinem zufälligen Stolpern über “Mach den Staat” bin ich fest überzeugt: So könnte demokratische Teilhabe in einer digitalen Gesellschaft aussehen. Nicht als gelegentlicher Wahlakt, sondern als kontinuierlicher Dialog, in dem jede Stimme zählt und direkt Wirkung entfalten kann.
Am meisten begeistert mich das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Politik ist nicht länger etwas, das “die da oben” machen – es ist ein gemeinschaftlicher Prozess, an dem ich jeden Tag teilhaben kann, wenn ich möchte. Und das Beste: Ich kann selbst entscheiden, bei welchen Themen ich mich einbringe und wie intensiv.
[HINWEIS: Dies ist eine hypothetische Darstellung. Die hier beschriebene Plattform existiert in dieser Form noch nicht, sondern stellt ein Konzept dar, wie kontinuierliche demokratische Beteiligung funktionieren könnte.]
Mara Berger ist eine fiktive Person. Dieser Beitrag wurde vollständig durch künstliche Intelligenz generiert, um die Konzepte und Prozesse von “Mach den Staat” und des Kontinuierlichen Einigungsfindungsprozesses (KEF) zu veranschaulichen. Die beschriebenen Erfahrungen und die Plattformfunktionalität basieren auf den vorgelegten Konzeptdokumenten und stellen eine mögliche Implementierung dar.
 kontakt@machdenstaat.de
kontakt@machdenstaat.de