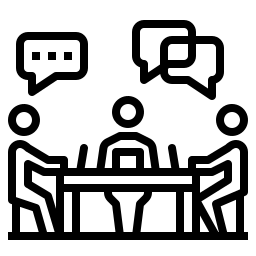Kontextdefinition
Der erste Schritt, die Kontextdefinition, bildet das Fundament des gesamten Konsensprozesses. Eine präzise und von allen getragene Kontextdefinition ist entscheidend für den Erfolg der nachfolgenden Schritte.
Verfeinerter Prozess der Kontextdefinition
1. Thematische Vorstrukturierung
Methodik:
- Initiale Sammlung relevanter Aspekte des Themas durch ein Kernteam
- Literaturrecherche zu bestehenden Diskussionen und Problemstellungen
- Experteninterviews zur ersten Orientierung im Themenfeld
- Erstellung einer vorläufigen Themenkarte (Mind Map oder Konzeptdiagramm)
Beispiel: Für ein Konsensdokument zum Thema “Zukunft der Arbeit nach COVID-19” könnte die Vorstrukturierung folgende Kategorien umfassen:
- Räumliche Aspekte (Homeoffice, hybride Modelle, Büroflächen)
- Zeitliche Aspekte (Flexibilisierung, Arbeitszeitmodelle)
- Technologische Aspekte (Kollaborationstools, digitale Infrastruktur)
- Organisatorische Aspekte (Führungsmodelle, Teamstruktur)
- Soziale Aspekte (Wohlbefinden, Work-Life-Balance)
2. Stakeholder-Mapping und -Einbindung
Methodik:
- Systematische Identifikation aller relevanten Interessengruppen
- Analyse von Macht, Interesse und Einfluss der Stakeholder
- Entwicklung eines Einbindungsplans für verschiedene Stakeholder-Gruppen
- Frühzeitige Kommunikation mit Schlüsselakteuren
Beispiel für ein Stakeholder-Mapping:
| Stakeholder | Interesse | Einfluss | Einbindungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmervertretungen | Hoch | Hoch | Direkte Beteiligung an Pol.is, Interviews |
| KMU-Vertreter | Mittel | Mittel | Fokusgruppen, Pol.is-Teilnahme |
| Großunternehmen | Hoch | Hoch | Interviews, Direkte Beteiligung |
| Arbeitsrechtexperten | Mittel | Hoch | Fachliche Beratung, Review |
3. Einsatz von Pol.is zur Themenfindung
Methodik:
- Erstellung einer initialen Pol.is-Umfrage mit breiten Themenaussagen
- Offene Phase für Teilnehmer, eigene Aussagen zu ergänzen
- Abstimmungsphase mit Bewertung aller Aussagen
- Analyse der Meinungslandschaft und Identifikation von Themenclustern
Konkrete Umsetzung:
- Formulierung von 15-20 initialen Aussagen zu potenziellen Kontextaspekten
- Einladung aller identifizierten Stakeholder zur Teilnahme
- Aktives Monitoring der Teilnahme und gezielte Nachfassaktionen
- Wöchentliche Zwischenanalysen zur Steuerung des Prozesses
4. Systemisches Konsensieren zur Kontextabgrenzung
Methodik:
- Ableitung konkreter Kontextvorschläge aus den Pol.is-Ergebnissen
- Formulierung als klare, abgrenzbare Themenbereiche
- Messung des Widerstands gegen jeden Themenbereich (0-10 Skala)
- Auswahl der Themenbereiche mit geringstem Gesamtwiderstand
Beispiel-Prozess:
- Aus Pol.is werden 10 potenzielle Themenbereiche identifiziert
- Jeder Stakeholder bewertet seinen Widerstand gegen jeden Bereich
- Die 5-7 Bereiche mit geringstem Widerstand werden in den Kontext aufgenommen
- Bei Unklarheiten werden Kompromissformulierungen entwickelt
5. Kontextdefinition und -validierung
Methodik:
- Ausformulierung eines Kontextdokuments basierend auf konsentierten Themenbereichen
- Präzise Definition von Ein- und Ausschlüssen
- Entwicklung eines gemeinsamen Glossars für Schlüsselbegriffe
- Feedbackschleife mit allen Stakeholdern zur Validierung
Konkreter Aufbau des Kontextdokuments:
- Präambel mit übergeordneter Zielsetzung
- Klar definierte Themenbereiche mit Begründung
- Explizit ausgeschlossene Themenbereiche mit Begründung
- Zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich
- Glossar der Schlüsselbegriffe
Arbeitsergebnisse für das Konsensdokument
Aus dem ersten Schritt ergeben sich folgende konkrete Beiträge zum Konsensdokument:
-
Kontextdefinitionsdokument
- Präzise Definition des Geltungsbereichs
- Eingeschlossene und ausgeschlossene Themenbereiche
- Zeitliche und räumliche Abgrenzung
- Bezug zu übergeordneten Zielen oder Strategien
-
Pol.is-Analysebericht
- Visualisierung der Meinungslandschaft
- Identifizierte Themenbereiche und ihr Konsensgrad
- Darstellung von Meinungsgruppen und ihren Charakteristika
- Brückenthemen zwischen verschiedenen Interessengruppen
-
Stakeholder-Analyseportfolio
- Übersicht aller beteiligten Stakeholder
- Beschreibung ihrer Interessen und Positionen
- Dokumentation der Einbindungsmaßnahmen
- Analyse der Beteiligungsintensität und -qualität
-
Konzeptuelles Rahmenmodell
- Visualisierung der Zusammenhänge zwischen Themenbereichen
- Darstellung der Beziehungen zwischen Stakeholdern und Themen
- Identifikation von Schnittstellenthemen
- Übersicht über Abhängigkeiten und Einflussfaktoren
-
Terminologisches Grundlagendokument
- Glossar mit definierten Schlüsselbegriffen
- Referenzierung von relevanten Standards oder Normen
- Sprachregelungen für mehrdeutige Begriffe
- Übersetzungstabellen für verschiedene Fachsprachen
Diese Arbeitsergebnisse bilden eine solide Grundlage für die nachfolgenden Schritte und stellen sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis des Kontextes haben. Sie dienen gleichzeitig als Referenzdokumente für den gesamten weiteren Prozess und helfen, Missverständnisse zu vermeiden und eine fokussierte Diskussion zu ermöglichen.
 kontakt@machdenstaat.de
kontakt@machdenstaat.de